Zeiterfassungspflicht auch bei Vertrauensarbeitszeit: Gewerkschaften fordern mehr Kontrolle
Hintergrund: Warum rückt die Zeiterfassung bei Vertrauensarbeitszeit ins Zentrum der Debatte?
Die Frage, wie Arbeitszeiten erfasst werden sollen, erlebt aktuell eine neue Brisanz: Gewerkschaften fordern, dass auch bei der sogenannten Vertrauensarbeitszeit eine systematische Zeiterfassung verpflichtend für den Arbeitgeber bleibt.
In vielen Unternehmen ist Vertrauensarbeitszeit ein etabliertes Modell: Beschäftigte können ihre Arbeitszeit frei einteilen, ohne feste Vorgaben von Beginn oder Ende der Arbeitszeit. Gerade bei Wissensarbeitern und Führungskräften gilt dieses Modell als Zeichen von gegenseitigem Vertrauen und Flexibilität. Doch der Druck wächst, auch hier die Arbeitszeiten lückenlos zu dokumentieren, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und große Einzelgewerkschaften wie ver.di betonen.
Rechtslage und aktuelle Entwicklungen
Auslöser für die aktuelle Diskussion sind höchstrichterliche Urteile und zunehmende EU-Vorgaben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat bereits 2019 entschieden, dass Unternehmen grundsätzlich verpflichtet sind, ein objektives, verlässliches und zugängliches System zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit einzuführen. Daraus resultiert auch in Deutschland gesetzgeberischer Handlungsbedarf: Die Bundesregierung plant, die Arbeitszeiterfassung noch in diesem Jahr gesetzlich neu zu regeln – dabei sollen aber „großzügige Ausnahmen“ für Vertrauensarbeitszeit geschaffen werden. Gewerkschaften kritisieren genau das. In der aktuellen Debatte wird deutlich, dass die Bundesregierung großzügige Ausnahmen für Vertrauensarbeitszeit erwägt, während die Gewerkschaftsseite vehement widerspricht.
Kernpunkte der Forderungen der Gewerkschaften
- Lückenlose Erfassung aller Arbeitszeiten, auch bei Vertrauensarbeitszeit
- Schutz vor Überlastung und unbezahlter Mehrarbeit
- Keine generellen Ausnahmen für bestimmte Beschäftigtengruppen oder Branchen
DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel argumentiert, dass Ausnahmen für Vertrauensarbeitszeit nicht mit dem EU-Recht vereinbar sind. Auch die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis fordert, dass Vertrauensarbeitszeit nicht als Umgehungsmöglichkeit bestehender Arbeitszeitgesetze dienen darf. Die Gewerkschaften betonen, dass sie das Prinzip der Vertrauensarbeitszeit nicht abschaffen, sondern rechtssicher ausgestalten wollen.
Vertrauensarbeitszeit versus Zeiterfassung: Ist das ein Widerspruch?
Vertrauensarbeitszeit und Zeiterfassung lassen sich nach Ansicht vieler Experten durchaus miteinander verbinden. Die wesentliche Flexibilität – nämlich, dass Beschäftigte selbst über Beginn und Ende der Arbeit entscheiden – bleibt erhalten. Allerdings müssten die tatsächlich geleisteten Stunden, inklusive Pausen und Ruhezeiten, präzise dokumentiert werden. Kritiker befürchten dadurch allerdings einen Verlust an Autonomie und einen höheren bürokratischen Aufwand.
Im Vergleich zur Gleitzeit, bei der es meist noch feste Kernarbeitszeiten gibt, bietet Vertrauensarbeitszeit mehr Freiraum – aber eben auch größere Graubereiche bezüglich Arbeitszeitüberschreitungen, die mit einer Zeiterfassung klarer werden könnten.
Praktische Aspekte und geplante Übergangsfristen
Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht vor, Übergangsfristen für kleine und mittelständische Unternehmen festzulegen. So soll der administrative Aufwand beherrschbar bleiben. Konkrete Details zur Umsetzung und den Fristen werden noch im Gesetzgebungsverfahren nachgebessert.
Beispiel aus der Wirtschaft: Umgang von Unternehmen mit der Pflicht zur Zeiterfassung
Große Konzerne wie SAP oder Siemens setzen schon länger auf digitale Erfassungstools, während kleinere Unternehmen oft mit der Einführung ringen. Für viele Beschäftigte und Betriebe bedeutet die Zeiterfassung eine Umstellung der innerbetrieblichen Abläufe, zum Beispiel durch Apps oder Software-Lösungen, welche die Arbeitszeiten automatisch erfassen. Gerade im Mittelstand werden daher pragmatische, leicht umsetzbare Lösungen gefordert.
Chancen und Risiken: Eine Analyse möglicher Auswirkungen
- Vorteile:
- Besserer Schutz vor unbezahlter Mehrarbeit und Überlastung
- Mehr Transparenz über tatsächliche Arbeitszeiten
- Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Nachteile:
- Mehr Bürokratie und Administrationsaufwand
- Gefahr, dass flexible Arbeitsmodelle an Attraktivität verlieren
- Technische und organisatorische Hürden für kleine Unternehmen
In Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Zeiterfassungspflicht auch bei Vertrauensarbeitszeit zum Standard wird – zumindest dort, wo dies europarechtlich erforderlich ist. Während sich Unternehmen auf einen gewissen Mehraufwand einstellen müssen, profitieren Beschäftigte von mehr Schutz und klareren Arbeitszeitregelungen. Wirtschaft und Gesellschaft dürften einen Wandel zu einer transparenteren, faireren Arbeitskultur erleben. Erwartet wird, dass pragmatische digitale Lösungen die Umsetzung erleichtern und so die Balance zwischen Flexibilität und Kontrolle verbessern. Es bleibt spannend, inwieweit gesetzliche Regeln und unternehmerische Praktiken sich künftig gegenseitig beeinflussen werden.


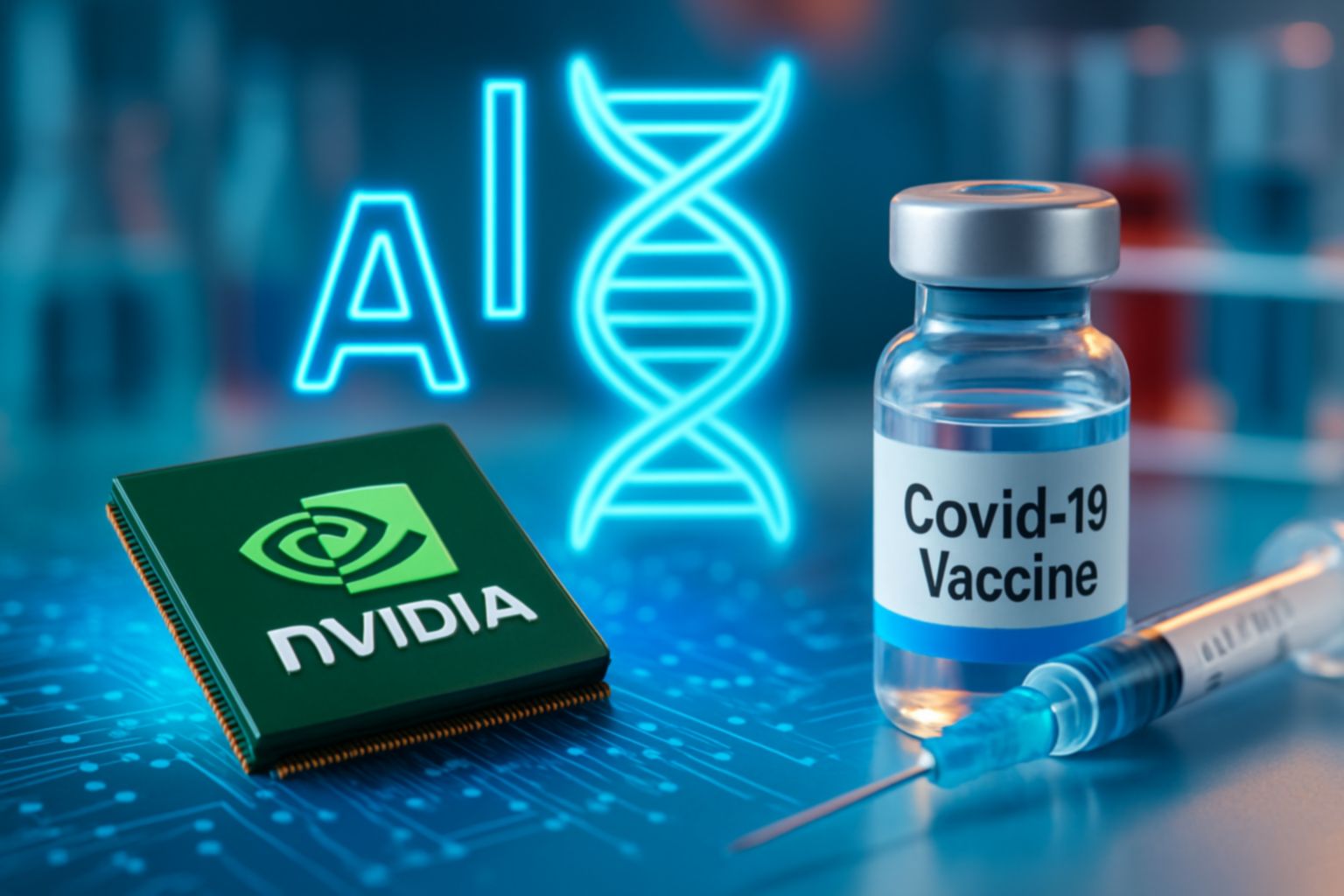






















Kommentar abschicken