Neuer Bluttest zeigt: Spike-Protein im Blut fast aller Menschen – Was steckt dahinter?
Das Spike-Protein: Im Blut vieler – Skandal oder erwartbare Folge des Pandemie-Managements?
Fast täglich erreichen uns neue Meldungen über die medizinischen und gesellschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Jüngst sorgt das Thema Spike-Protein-Nachweis im Blut international für Aufregung: Neue Bluttests zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung, darunter sowohl Genesene als auch Geimpfte, noch nach Monaten Spuren des Spike-Proteins aufweist. Ist das eine neue Entwicklung mit brisanten Folgen, oder liefert die Wissenschaft plausible Erklärungen und Entwarnung?
Wie gelangt das Spike-Protein in den Körper?
Das Spike-Protein ist ein charakteristischer Bestandteil von SARS-CoV-2 und dient als „Schlüssel“, mit dem das Virus in menschliche Zellen eindringt. Es gibt zwei wesentliche Szenarien, wie das Spike-Protein ins Blut gelangen kann:
- Natürliche Infektion: Während oder nach einer SARS-CoV-2-Infektion findet sich das Spike-Protein im Blut und teils in bestimmten Zelltypen.
- Impfung: Die gängigen Corona-Impfstoffe (mRNA-, Vektorimpfstoffe) induzieren die Produktion des Spike-Proteins durch körpereigene Zellen, um eine Immunantwort hervorzurufen.
Im Zuge der globalen Impfkampagne und der vielen Infektionen weltweit ist es wenig überraschend, dass Spike-Protein-Fragmente in so vielen Menschen nachweisbar sind.
Was zeigt der neue Bluttest?
Mediziner und Forscher, etwa aus den USA und Deutschland, setzen hochsensitive Methoden wie Fluoreszenz-Durchflusszytometrie und Massenspektrometrie ein, um das Spike-Protein nachzuweisen. Studien belegen, dass selbst Monate nach Infektion oder Impfung Spike-Protein-Fragmente – insbesondere das S1-Fragment – in bestimmten Immunzellen, wie CD16+ Monozyten, zu finden sind. Auffällig: Dies betrifft sowohl Menschen mit Long COVID-Symptomen als auch solche mit sogenannten Post-Vaccine Syndromen. (Studie im „International Journal of Molecular Sciences“).
Eine aktuelle Arbeit aus dem Jahr 2025 wies bei Personen mit persistierenden Beschwerden nach Impfung (PCVS) die S1-Spike-Fragmente in Immunzellen über 30 Tage nach (PubMed-Quelle). Dies ersetzt jedoch keine präzise Prävalenzstatistik.
Ist fast jede:r betroffen? Wissenschaftliche Einordnung
Statistisch gesehen hatten bis 2025 weltweit Milliarden Menschen entweder Kontakt zum Virus (Infektion) oder wurden geimpft. Beide Gruppen bilden für Wochen bis Monate Spike-Protein – und das Immunsystem eliminiert dies meist effektiv (Frontiers in Cellular Neuroscience).
Es gibt Hinweise, dass ein geringer Anteil Spike-Protein-Fragmente länger speichert, möglicherweise verbunden mit anormalen Immunreaktionen oder persistierender Entzündung, wie es etwa bei Long COVID oder seltenen Impffolgen der Fall ist. Für die Mehrheit scheint das Spike-Protein jedoch schnell vom Körper abgebaut und unschädlich gemacht zu werden.
Forschungsschwerpunkte und Diskussionen
- Langzeitfolgen: Wissenschaftlich intensiv untersucht wird, ob persistierende Spike-Protein-Fragmente zu chronischen Entzündungen oder immunologischen Dysregulationen führen, speziell bei Long COVID und PCVS.
- Blut-Hirn-Schranke: Tierstudien zeigen, dass das Spike-Protein das ZNS erreichen kann und eventuell neurologische Spätsymptome begünstigt. Beim Menschen sind solche Effekte noch nicht eindeutig bestätigt.
- Unterschiedliches Abbauverhalten: Zwischen Geimpften und Genesenen gibt es offenbar Unterschiede in Geschwindigkeit und Form des Spike-Protein-Abbaus (Antikörperbindung, immunologische Clearance).
Fallbeispiele und Statistische Einordnung
Eine vielzitierte Studie aus Boston konnte nach COVID-19-Infektion bis zu einem Drittel der Patienten zirkulierendes Spike-Protein nachweisen, Wochen nach Abklingen der Infektion. Nach Booster-Impfungen konnte das Protein bei Erwachsenen meist nicht mehr nachgewiesen werden, da Antikörper es schnell eliminierten. Bei Jugendlichen erschien das Bild uneinheitlicher.
Perspektiven in Gesellschaft und Wirtschaft
Die Entdeckung und Standardisierung sensibler Spike-Protein-Tests hat potenzielle Auswirkungen für folgende Bereiche:
- Diagnostik: Die Tests könnten helfen, persistierende Symptome leichter spezifisch zuzuordnen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag bei der Differenzierung zwischen Long COVID und anderen postinfektiösen oder postvakzinalen Syndromen.
- Arzneimittelentwicklung: Das Wissen über langfristige Präsenz von Spike-Protein könnte Impulsgeber für neue Therapien gegen chronische Entzündungen werden.
- Versicherungswirtschaft und Arbeitswelt: Erkenntnisse über potenzielle Langzeitfolgen haben direkten Einfluss auf Versicherungsmodelle und langfristige Arbeitsfähigkeitseinschätzungen.
Die aktuellen Erkenntnisse zeigen: Das Spike-Protein lässt sich mittels moderner Technologien bei sehr vielen Menschen im Blut nachweisen – besonders in den Monaten nach Infektion und/oder Impfung. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist dieser Nachweis jedoch kein Grund zur Sorge; das Immunsystem baut die Proteine in der Regel zügig ab, ohne langfristige Folgen. Problematisch kann die Persistenz des Spike-Proteins für eine kleine Minderheit werden, die an Long COVID oder Impf-Nebenwirkungen leiden. Hier gibt es Handlungsbedarf: von besserer Diagnostik über gezielte Therapien bis zur gesellschaftlichen und arbeitsrechtlichen Einordnung. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Forschung den Nachweis und die Bewertung von Impf- und Infektionsfolgen weiter verfeinert und individuelle Risikoprofile berücksichtigt. Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft profitieren – wenn mit Augenmaß zwischen begründeter Vorsicht und neuer Hysterie unterschieden wird.
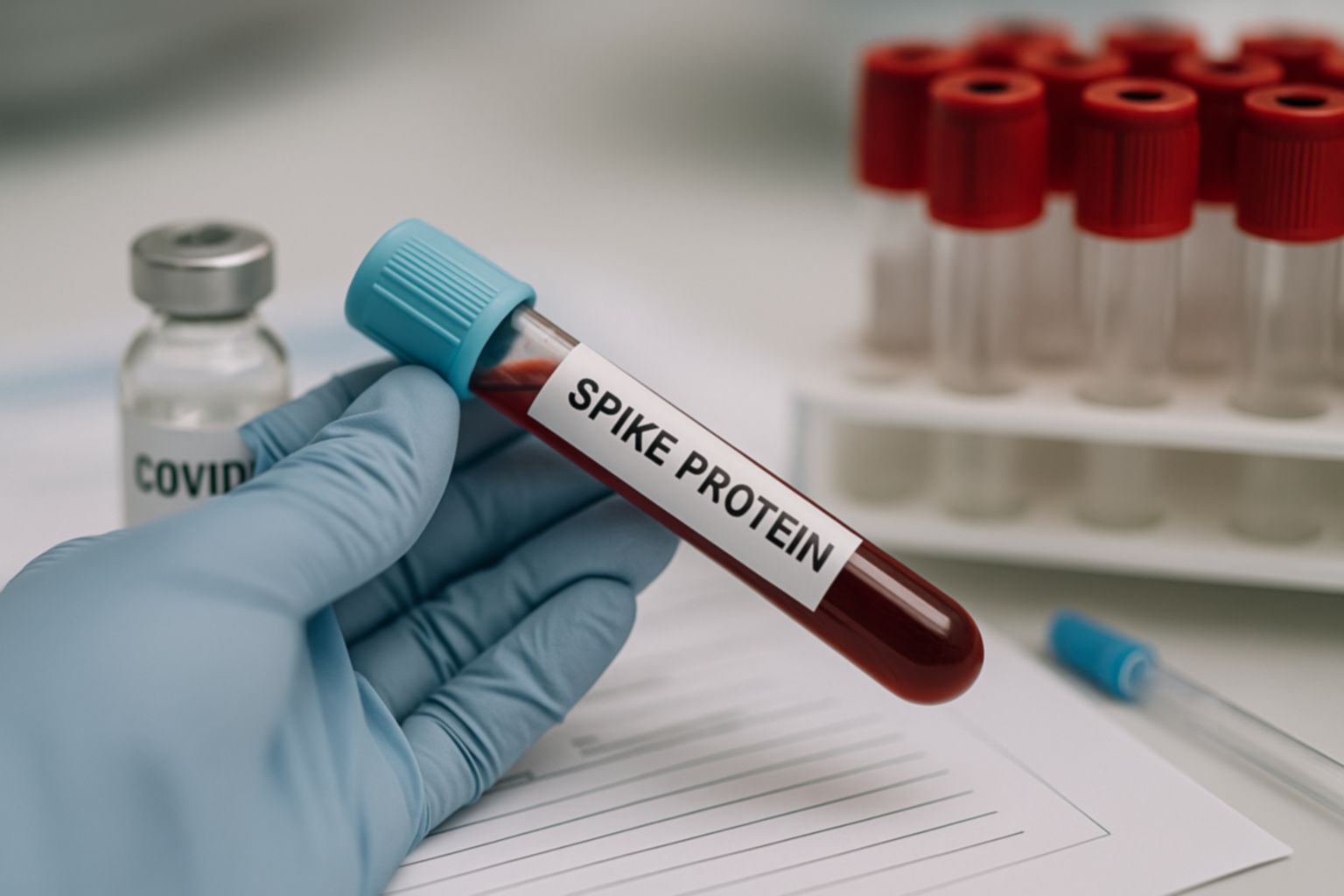













Kommentar veröffentlichen