Forschungsdatengesetz: Warum Wirtschaft und Wissenschaft auf Reformen drängen
Wieviel Innovationskraft verschenkt Deutschland, weil wissenschaftliche und wirtschaftliche Akteure nur eingeschränkten Zugang zu Forschungsdaten haben? Dieser Frage stellt sich aktuell eine breite Allianz aus Wirtschaft und Wissenschaft und fordert unter Verweis auf europäische Vorbilder die rasche Verabschiedung und pragmatische Umsetzung des Forschungsdatengesetzes. Der Handlungsdruck steigt, denn internationale Beispiele zeigen: Wer Daten intelligent nutzt, schafft Vorsprung – etwa im Gesundheitswesen, bei der Energiewende oder der Mobilitätsforschung.
Die Eckpunkte und Ziele des geplanten Forschungsdatengesetzes
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat bereits im Februar 2024 ein Eckpunktepapier für das Forschungsdatengesetz (FDG) veröffentlicht. Das Ziel: Einen verbesserten, rechtssicheren und datenschutzkonformen Zugang zu Forschungsdaten für Universitäten, Forschungseinrichtungen und die Wirtschaft schaffen – bei gleichzeitiger Wahrung sensibler Informationen. Das Gesetz bleibt damit Antwort auf die Forderung aus dem Koalitionsvertrag, das Potenzial großer Datenmengen für Austausch, Vergleich und Fortschritt optimal zu nutzen (Quelle 1).
Drei zentrale Problempunkte
- Zugang zu öffentlichen Verwaltungs- und Forschungsdaten: Wissenschaft wie Unternehmen klagen, dass sie vor allem auf staatliche und administrative Datenbestände oft nur in Spezialfällen zugreifen können. Der europäische Vergleich zeigt: Andernorts sind Datenverknüpfungen mit geeigneten Schutzmaßnahmen längst Standard (Quelle 2).
- Datenverknüpfung und Interoperabilität: Oft sind Datensätze nicht nur getrennt gespeichert, sondern auch technisch und rechtlich inkompatibel. Das geplante Gesetz soll einen klaren Rahmen schaffen, wie verschiedene Quellen kombiniert werden dürfen.
- Forschungsermöglichender Datenschutz: Die Balance zwischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Forschungsinteresse bleibt eine Herausforderung. Das Gesetz will Rechtssicherheit für Unternehmen und öffentliche Akteure gleichermaßen schaffen.
Wie gestaltet sich die aktuelle Debatte?
Viele Stimmen aus Wissenschaft und Wirtschaft kritisieren, dass das Forschungsdatengesetz inmitten wechselnder politischer Konstellationen stockt: Nach dem Ende der aktuellen Koalition ist die Umsetzung offenbar erneut in Gefahr geraten (Quelle 3). Gerade internationale Standorte wie die Niederlande, Dänemark oder Finnland haben in den letzten Jahren wirksame Forschungsdatenregulierungen eingeführt: Sie gestatten den kontrollierten Fernzugriff auf sensible Daten, fördern datengetriebene Innovation und stärken das Vertrauen in Wissenschaft und Politik. Auch in Deutschland werden diese Features als prioritär gesehen, insbesondere der gesicherte Fernzugriff auf pseudonymisierte Daten, der derzeit nur sehr eingeschränkt möglich ist.
Doch es geht nicht nur um Wissenschaftsfreiheit, sondern auch um konkrete Produktivitätssprünge: So erhoffen sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen schnellere Innovationszyklen, weil administrative und wissenschaftliche Informationen zusammengebracht und analysiert werden können. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) betonen, dass moderne Datenräume den Technologietransfer und die Entwicklung von KI-gestützten Geschäftsmodellen massiv beschleunigen könnten.
Fallbeispiel: Gesundheitsdaten und Innovation
Im Gesundheitsbereich können kontrolliert freigegebene, anonymisierte Daten Leben retten – zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Therapien, der Auswertung von Nebenwirkungen oder der schnellen Analyse von Pandemien. Die Gegenwart in Deutschland zeigt jedoch, dass Datenschutz und Rechtsunsicherheit oft den Austausch solcher Daten verhindern. Unternehmen im Bereich Biotechnologie und Medizinforschung verlieren dadurch entscheidende Wettbewerbszeit.
Bisherige Erfolge und Hürden
- Positive Ansätze: Das Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit arbeitet bereits mit kontrolliert pseudonymisierten Datensätzen, doch diese Praxis bleibt die Ausnahme.
- Hürden: Komplexe Datenschutzregelungen, fragmentierte Zuständigkeiten und fehlende Klarheit über rechtliche Befugnisse bremsen viele Projekte aus. Wichtig ist, echte Interoperabilität und praktischen Anreiz für die Datenteilung zu schaffen.
Die Diskussion um das Forschungsdatengesetz ist dabei mehr als nur eine technische Reform: Sie wird zu einem Schlüsselprojekt für die datengetriebene Transformation der gesamten Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland.
Eine beschleunigte und klar geregelte Umsetzung des Forschungsdatengesetzes könnte für Wissenschaft wie Wirtschaft in Deutschland erhebliche Vorteile bringen: Mehr Innovation, international wettbewerbsfähige Forschung, eine höhere Produktivität und smartere politische Steuerung durch zuverlässige Statistiken. Allerdings bestehen auch Herausforderungen: Datenschutz muss praxistauglich gestaltet werden, um das Vertrauen der Bevölkerung zu sichern und Missbrauch zu verhindern. Kurzfristig verlangt dies Ressourcen und Abstimmungsaufwand – lohnt sich aber langfristig für alle Beteiligten. In Zukunft ist zu erwarten, dass Datenräume, sichere Infrastruktur und transparente Rechtslagen entscheidende Standortvorteile schaffen. Menschen, Unternehmen und die gesamte Gesellschaft werden davon profitieren, wenn Daten kontrolliert, sicher und verantwortungsvoll genutzt werden können.
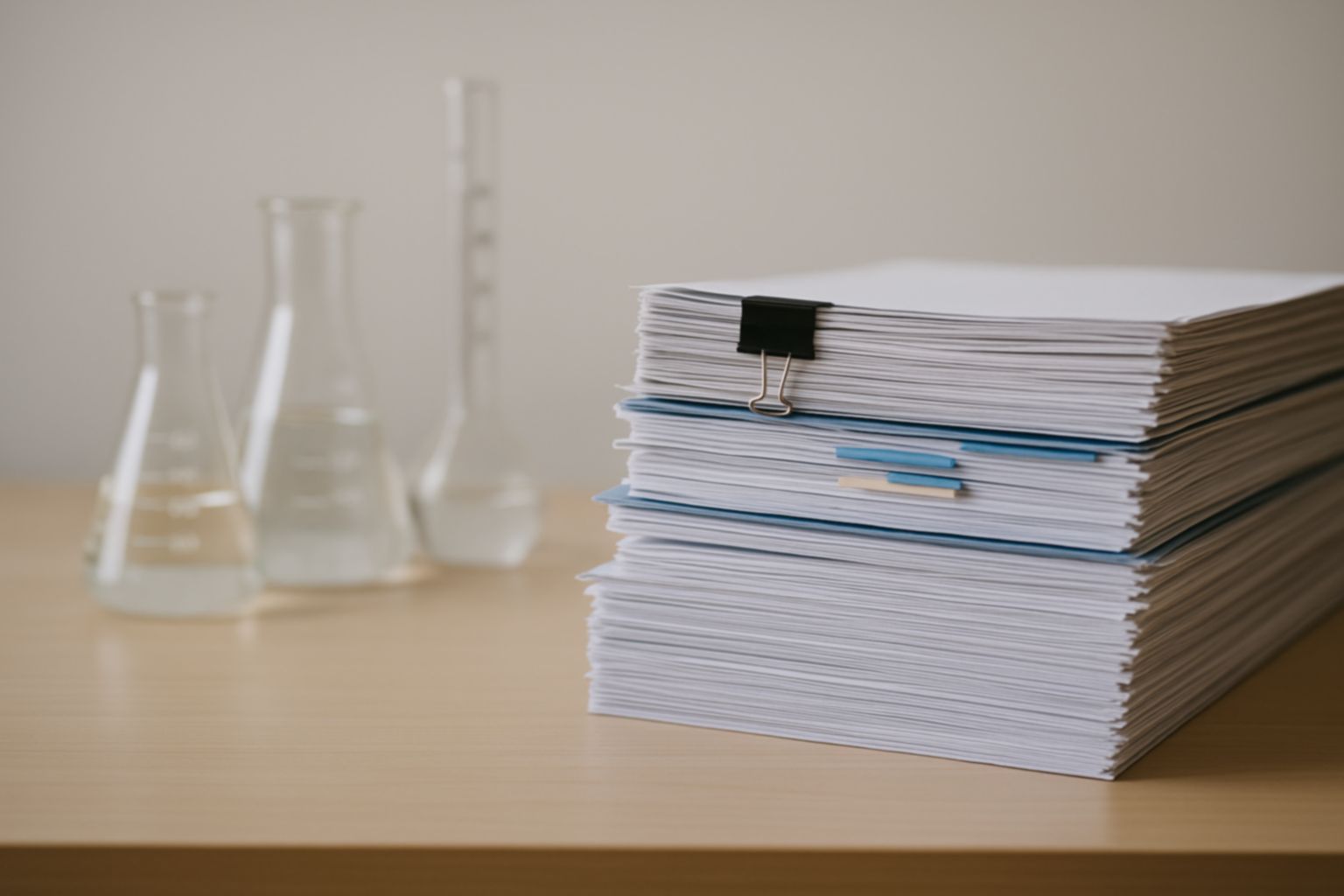
























Kommentar abschicken