Diskriminierung bei Ausbildungsplatzbewerbungen: Studie belegt strukturelle Benachteiligung durch Herkunft und Namen
Chancengleichheit in Gefahr: Studien belegen Diskriminierung bei Ausbildungsplatzsuche
Warum müssen Bewerber mit türkisch klingenden Namen deutlich mehr Bewerbungen verschicken, um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten? Diese Frage haben Forscher:innen mithilfe aktueller Feldstudien untersucht – die Ergebnisse sind ernüchternd für Deutschlands Ausbildungsmarkt.
Studienlage: Herkunft und Name beeinflussen Zugang zum Ausbildungsmarkt
In Deutschland haben Jugendliche mit Migrationshintergrund nach wie vor deutlich schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz, auch wenn ihre Qualifikationen identisch zu denen ihrer Mitbewerber:innen sind. Ein Korrespondenztest des SVR-Forschungsbereichs zeigt: Jugendliche mit ausländisch klingenden Namen müssen signifikant mehr Bewerbungen schreiben als Bewerber:innen ohne Migrationshintergrund, um überhaupt zu einem Gespräch eingeladen zu werden. Besonders stark betroffen sind hierbei kleine Betriebe mit weniger als sechs Mitarbeiter:innen, während mittlere und große Unternehmen weniger häufig diskriminieren.
Reale Ungleichbehandlung – empirisch belegt
Eine aktuelle Untersuchung zur Diskriminierung am Ausbildungsmarkt nutzte fingierte Bewerbungen und verglich die Erfolgsaussichten von identisch qualifizierten Bewerber:innen mit deutschen und türkischen Namen. Bereits die Rücklaufquoten offenbaren einen deutlichen Unterschied: In über 14 % der Fälle erhielten ausschließlich Bewerber:innen mit deutschem Namen eine Rückmeldung, während nur knapp 9 % ausschließlich Bewerber:innen mit türkischem Namen antworteten. Der wahre Umfang der Diskriminierung, die sogenannte Nettodiskriminierung, liegt laut Studie bei rund 5 Prozentpunkte.
Hinzu kommt: Um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen, mussten Bewerber:innen mit deutschem Namen im Schnitt vier (Kfz-Mechatroniker) beziehungsweise sechs (Bürokaufmann/-frau) Bewerbungen schreiben. Für ihre türkisch klingenden Pendants stieg die Zahl in beiden Berufen jeweils auf sieben Bewerbungen. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant und lassen sich ausschließlich auf den Namen zurückführen.
Weiterführende Informationen und Details zu Zahlen finden sich direkt in der Süddeutschen Zeitung.
Ursachen und Auswirkungen
Die Gründe für diese Diskriminierung sind vielfältig: Unbewusste Vorurteile („unconscious bias“) spielen eine Rolle, außerdem Stereotype, gesellschaftspolitische Unsicherheiten und ein Mangel an interkultureller Kompetenz vieler Ausbildungsbetriebe. Die Folgen sind gravierend: Einerseits geht den Unternehmen wertvolles Fachkräftepotenzial verloren – eine doppelt problematische Entwicklung in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels. Andererseits wirken wiederholte Absagen auf Bewerber:innen mit Migrationshintergrund demoralisierend, was zu Resignation bis hin zum Rückzug aus dem Ausbildungssystem führen kann.
- Kleinere Betriebe diskriminieren häufiger – hier liegt die Nettodiskriminierungsquote bei über 11 %, während größere Betriebe deutlich weniger diskriminieren.
- Antwortverhalten: Bewerber:innen mit Migrationshintergrund erhalten insgesamt seltener Rückmeldungen und darunter etwas häufiger Absagen.
- Integrationspolitische Folgen: Diskriminierung in der Ausbildung schwächt das Vertrauen junger Menschen in gerechte Teilhabe und Integration.
Diskussion und Handlungsfelder
Die Studien machen deutlich: Ein diskriminierungsfreier Zugang zu Ausbildungsplätzen ist in Deutschland noch immer nicht gewährleistet. Insbesondere die Durchführung von anonymisierten Bewerbungsverfahren könnte helfen, Vorurteile in den frühen Auswahlstufen zu reduzieren. Ebenso sinnvoll sind Weiterbildungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für Ausbilder:innen und Personalverantwortliche – speziell im Bereich interkultureller Kompetenzen sowie „unconscious bias“.
Empfehlungen wie ein verpflichtendes interkulturelles Modul in der Ausbildung von Ausbilder:innen oder standardisierte Testverfahren bieten Ansatzpunkte, um gerechtere Zugänge zu schaffen.
Auch gesellschaftlich-politisch zieht das Thema Kreise. Mehr Informationen dazu und zur Reaktion der Politik finden sich im Tagesspiegel.
Als Best-Practice gelten viele (meist größere) Unternehmen, die proaktiv Diversität fördern und anonymisierte Bewerbungsverfahren testen oder bereits implementiert haben.
Diskriminierung bei der Ausbildungsplatzvergabe benachteiligt nicht nur die Betroffenen, sondern hemmt die Wirtschaftsleistung und verschärft den Fachkräftemangel in Deutschland. Vorteile einer konsequenten Antidiskriminierung wären ein breiteres, vielfältiges Bewerberfeld und eine gerechtere Talentselektion, was letztlich allen zugutekommt. Nachteile könnten kurzfristig in rechtlichem und bürokratischem Aufwand für Betriebe bestehen. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, wie konsequent Wirtschaft und Politik Antidiskriminierungsstrategien umsetzen und ob sich ein Bewusstseinswandel in Betrieben und Gesellschaft durchsetzt. In Zukunft ist zu erwarten, dass Maßnahmen wie anonymisierte Bewerbungen weiter an Bedeutung gewinnen. Von einer gerechteren Vergabe profitieren sowohl marginalisierte Gruppen als auch der gesamte Arbeitsmarkt, da Potenziale besser ausgeschöpft werden und Innovation durch Diversität wächst.
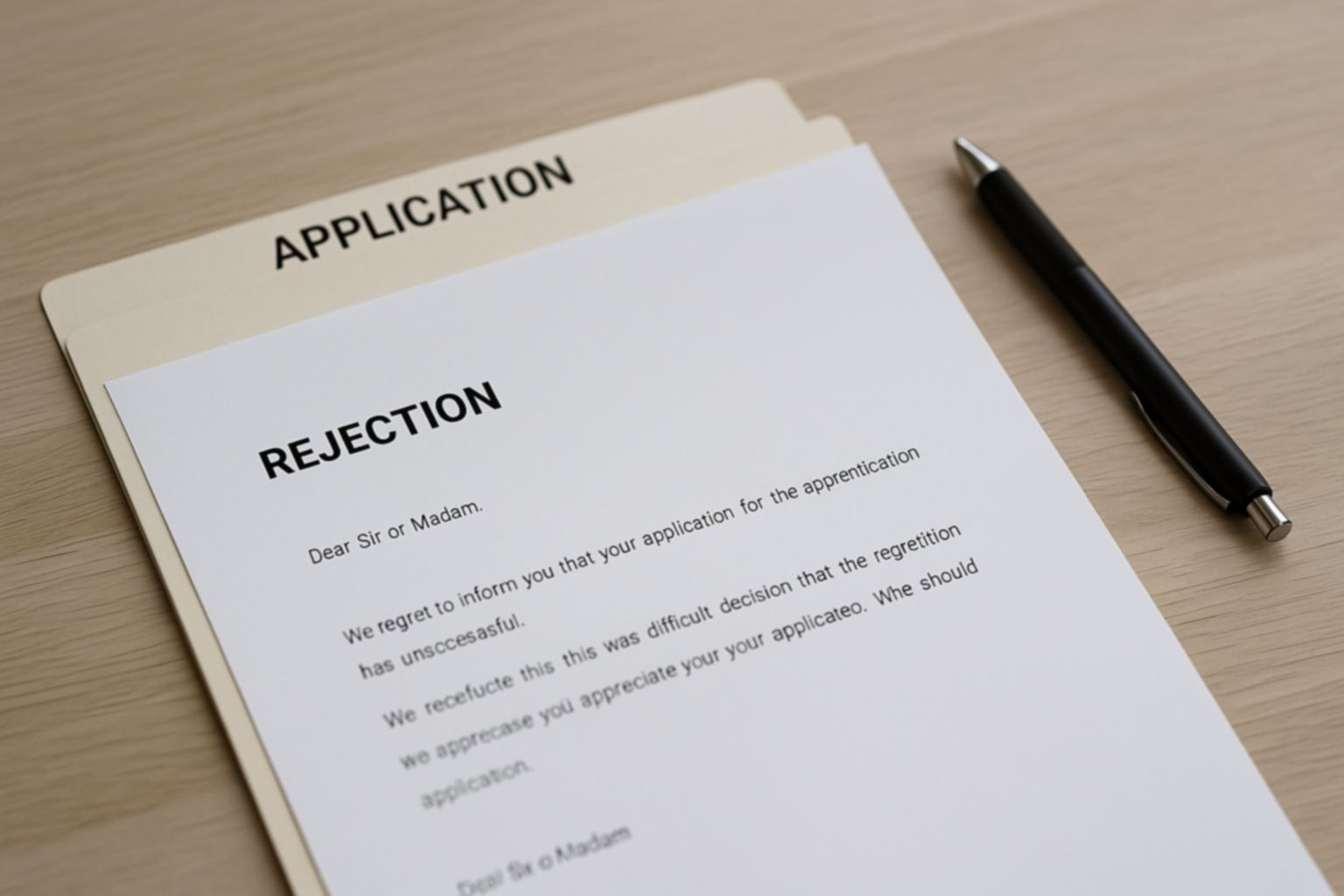



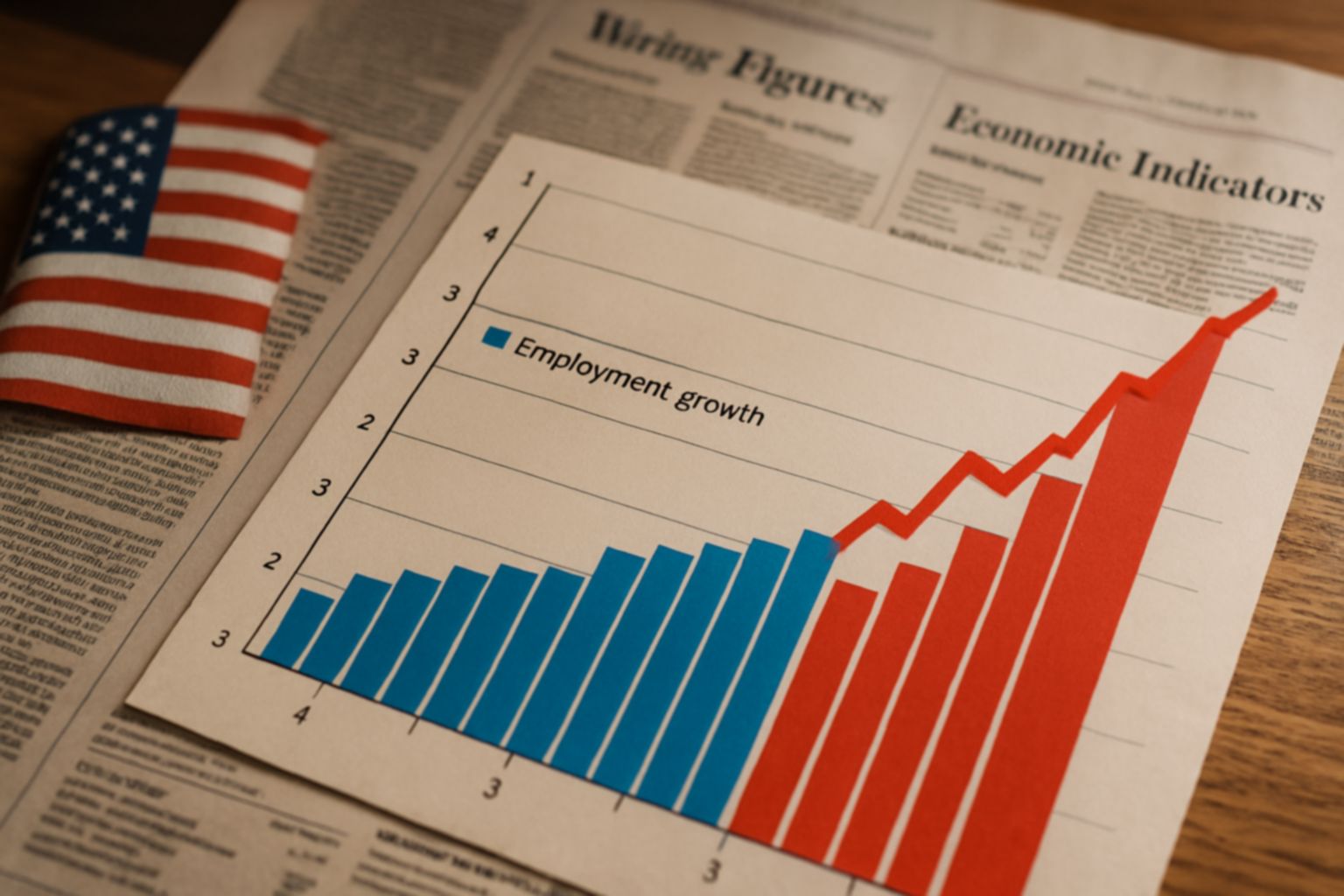




















Kommentar abschicken